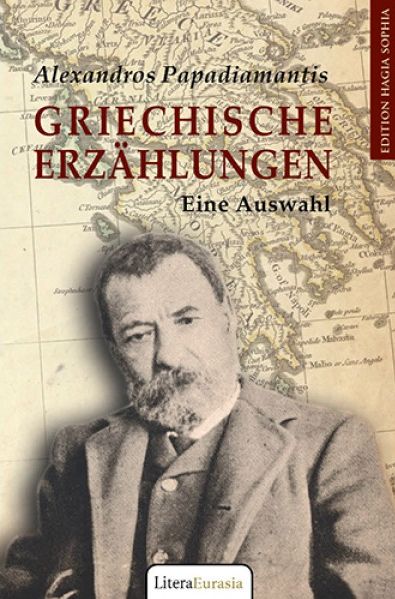Über die Buchreihe

Litera Eurasia ist eine Buchreihe aus dem Verlag Edition Hagia Sophia, die dem deutschen Leser vorzügliche, in christlichen Traditionen stehenden Werke ausländischer Autoren zugänglich macht.
Auf unserer Webseite bieten wir außerdem zahlreiche Leseproben und unveröffentlichte Texte zum Lesen an.
Das zeitgenössische Paterikon
Lektüre für von Mutlosigkeit Befallene
"Ein solches Buch hat es bisher noch nicht gegeben... Das »Zeitgenössische Paterikon« wurde in Russland innerhalb von vier Jahren fünfmal neu aufgelegt und Zitate daraus sind inzwischen schon zu geflügelten Worten geworden."